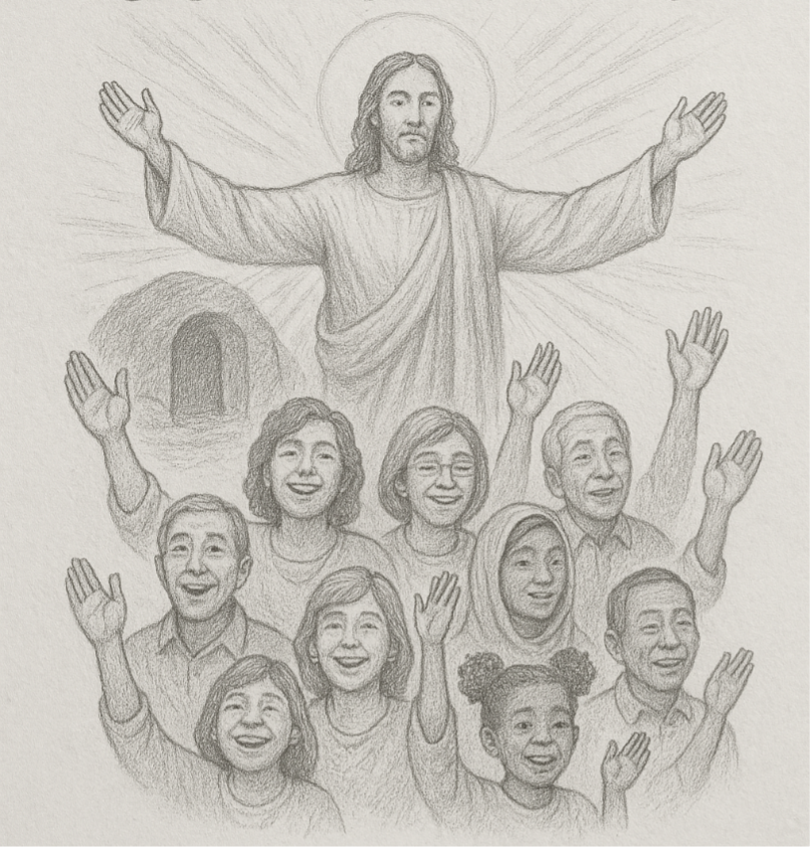
Evangelium nach Johannes 20,1-9:
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: «Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat».
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste.
Mit Ihm auferstehen
Luis CASASUS
Präsident der Missionarinnen und Missionare Identes
Rom, 20. April 2025 | Ostersonntag
Apg 10,34a.37–43; Kol 3,1–4; Joh 20,1–9
Die Frauen, die sich in aller Frühe auf den Weg zum Grab Jesu machten, „als es noch dunkel war“, waren eifriger als die Jünger, die durch sie benachrichtigt wurden. Aber immerhin liefen zwei von ihnen dorthin, um endlich zu begreifen, was Christus ihnen angekündigt hatte. Schlussfolgerung: Christus fordert von uns eine Anstrengung, um an seinem Reich teilzuhaben – etwas, das viele sogenannte moderne Atheisten nie unternommen haben, nämlich in ihr Innerstes zu schauen und zu sehen, was dort vor sich geht.
Das erklärt, warum unser Gründervater in seinen Transfigurationen einen aufrüttelnden Satz schreibt: Der Atheismus ist ein Denken, das vor der Anstrengung flieht.
Weder die Atheisten noch wir, die wir träge Christen sind, machen uns die Mühe, es jenen hilfsbereiten Frauen und überraschten Jüngern gleichzutun: sorgfältig zu erforschen, was in unserer Seele geschieht. Doch das würde uns erkennen lassen, wie viele Geschehnisse in unserem Leben geschehen, ohne dass wir es merken – und deren offensichtlichste Erklärung darin liegt, dass der Hauch des Heiligen Geistes uns – meist auf sanfte und zarte Weise – zu neuen Horizonten führt.
Das ist vergleichbar mit den Millionen chemischer Reaktionen, die täglich in unserem Körper ablaufen, oder mit der faszinierenden und stillen Produktion roter Blutkörperchen – zwei Millionen pro Sekunde. Wir wissen, dass dies geschieht, dass es lebensnotwendig ist, aber es entzieht sich unserer Kontrolle.
Die Erfahrung der Auferstehung ist nicht nur eine historische Erinnerung an das Ereignis, das wir an Ostern feiern, sondern eine existentielle Realität, die unser tägliches Leben prägt. Wie unser Gründervater so oft betont hat: Es handelt sich um etwas, das wir hier und jetzt erleben – nicht erst in der Zukunft. Etwas geschieht in uns:
Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. (vgl. Gal 4,6)
Genau deshalb fühlen wir uns gesandt, mit unserem Leben zu verkünden, dass das Licht über die Dunkelheit siegt. Und wir spüren, dass wir Hoffnung weitergeben können. Es ist ein Antrieb, mit Sinn, mit Ziel zu leben, in der Gewissheit, einem Vater zu dienen, der immer auf uns wartet. So erging es den Jüngern nach der Begegnung mit dem Auferstandenen.
Zu sagen, dass der Christ der Sünde stirbt und zu einem neuen Leben geboren wird (vgl. Röm 6,4), ist keine Metapher, sondern die genaueste Beschreibung unserer Teilhabe an der Auferstehung Christi. Christus musste nicht der Sünde sterben, doch er hat den Tod besiegt. Wir hingegen erfahren eine Distanz zur Kraft der Sünde – auch wenn wir manchmal fallen; wir spüren, dass wir eine tiefe Veränderung brauchen, eine wirkliche Auferstehung, selbst wenn uns keine konkrete Schuld ins Gedächtnis kommt. Der Gegensatz zwischen Tod und Leben beschränkt sich nicht auf das erhabene Ereignis, das wir heute im Leben Christi feiern.
Mit wohlbekannten Worten des hl. Paulus an Timotheus schloss hl. Johannes Paul II. seine Katechese über die Auferstehung:
„Denk an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist“ – diese Aussage des Apostels gibt uns den Schlüssel zur Hoffnung auf das wahre Leben in der Zeit und in der Ewigkeit. (15. März 1989)
—ooOoo—
In vielen Traditionen – wie dem Hinduismus, Buddhismus oder bestimmten philosophischen Strömungen – wird Reinkarnation verstanden als Rückkehr der Seele in einen neuen Körper, in einem wiederkehrenden Zyklus von Geburt und Tod, zur Reinigung oder Erleuchtung. Man könnte sagen, dass der Glaube an die Reinkarnation ein uraltes und intuitives Suchen nach jener Wahrheit ist, die der christliche Glaube in der Auferstehung offenbart.
Wie Johannes Paul II. in Evangelium Vitae sagt: „Der Mensch trägt in seinem Herzen die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. […] Die Auferstehung Christi antwortet nicht nur auf diese Hoffnung: Sie übertrifft sie unendlich.“
Vergessen wir nicht, dass auch die Jugend – die wir so oft als materialistisch, individualistisch oder relativistisch bezeichnen – dieses Sehnen nach Ewigkeit im Herzen trägt, auch wenn sie uns pessimistisch oder skeptisch erscheinen mögen.
Die Auferstehung schenkt uns eine tiefe Gewissheit: Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Christ erfährt Frieden mitten im Schmerz, sogar angesichts des physischen Todes, weil er glaubt und eine Vorahnung (eine Erstlingsgabe) des ewigen Lebens hat. Diese Hoffnung verändert die Weise, wie er die Gegenwart lebt: Er klammert sich nicht ans Vergängliche, sondern sucht auf vielfältige Weise das Ewige.
Würde ich das einem Kind erklären, dann so:
Es war einmal eine kleine Raupe namens Nuna, die in einem Garten voller Licht lebte. Jeden Tag kroch sie über grüne Blätter, blickte zum Himmel und hörte den Blumen zu. Obwohl ihre Welt klein war, träumte sie von mehr.
„Was liegt wohl jenseits dieser Pflanzen?“, fragte sie die Insekten, doch niemand antwortete. „Hier ist es gut“, sagten die Ameisen. „Es gibt nur Zweige und Wind.“
Eines Tages sprach eine Schmetterling mit sanfter Stimme: „Alles im Garten hat einen Sinn. Auch wenn du jetzt nah am Boden lebst – eines Tages wirst du fliegen.“
„Fliegen?“, fragte Nuna. „Ich bin klein, langsam… ich sehe kaum den Himmel.“
„Vertrau“, sagte eine alte Eiche. „Auch ich war einst ein Samen. Du wirst dich verändern. Fürchte dich nicht.“
Die Tage vergingen. Die Kälte kam. Nuna wurde von einem tiefen Schlaf ergriffen. Sie klammerte sich an einen Ast und spann einen Kokon – wie in einem Traum.
„Sie ist fort“, sagten die Grillen. „Eine gute Raupe. Ihre Geschichte ist zu Ende.“
Doch eines Morgens, als die Sonne den Garten küsste, öffnete sich der Kokon… und Nuna kam hervor, strahlend. Sie war keine Raupe mehr – sie war ein Schmetterling! Mit Flügeln aus Licht erhob sie sich in jenen Himmel, von dem sie so lange geträumt hatte.
—ooOoo—
Die Auferstehung ist kein punktuelles Ereignis: Sie ist eine tägliche Dynamik von Sterben und Neuwerden. Jedes Mal, wenn der Christ sich entscheidet zu lieben, zu vergeben, sich aus der Sünde zu erheben, in der Dunkelheit zu vertrauen… erfährt er etwas von der Auferstehung.
So sagt es Jesus selbst im Gleichnis vom verlorenen Sohn: „Er war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden.“ Immer wenn ich mich mit wahrer Einsicht dafür entscheide, meine Schuld gegenüber Gott und dem Nächsten zu bereuen, erkenne ich, dass ich mich von der Liebe entfernt hatte – und ich empfange eine Gnade, die nicht nur mein Verhalten verändert, sondern ein echtes Auferstehen ermöglicht. Ob ich das mit Dankbarkeit und Konsequenz annehme, ist eine andere Frage.
Ich kann nicht von der Auferstehung Christi (und meiner eigenen) sprechen, wenn man in meinem Leben kein Enthusiasmus für die Sendung erkennt, keine Dankbarkeit für mein Leben, meine Talente (selbst wenn sie unscheinbar sind). Neulich erinnerten wir uns in einem Gespräch daran, dass viele Freiwillige in onkologischen Kliniken frühere Krebspatienten sind – dankbar dafür, dass sie ihre Kräfte zurückgewonnen haben, auch wenn sie geringer sind als zuvor. Doch nach dieser „Auferstehung“ ihrer Gesundheit erkennen sie den Wert jeder Minute, jeder Gelegenheit zum Dienen, Trösten und Ermutigen.
Wer den Wunsch hat, Apostel zu sein, sollte spürbar sein in seinem Eifer und in der Aufmerksamkeit für die Sendung der Brüder – selbst bei der kleinsten Gelegenheit zu einem freundlichen Gespräch: mit dem Friseur, der Verkäuferin, einem Nachbarn. Eine Person, die dies NICHT TUT, die diese Einstellung nicht hat, sagte mir vor ein paar Tagen: Es reicht nicht aus, sympathisch und freundlich zu sein. Mag sein. Aber es ist der Anfang, das sichtbare Zeichen dessen, der an den anderen glaubt – nicht, weil sie vollkommen sind, sondern weil sie zu einem ewigen Leben berufen sind.
Der heilige Philipp Neri war für seine Heiligkeit bekannt… aber auch für seinen großartigen Humor. Er hatte eine besondere Gabe, die Menschen mit einem Lächeln zu Gott zu führen.
Einmal fühlte sich ein junger Adliger zur Spiritualität hingezogen – aber er hatte ein kleines Problem: Er kümmerte sich sehr um das, was andere von ihm dachten. Immer makellos gekleidet, achtete er auf sein Image und seinen Ruf. Der heilige Philipp bemerkte das. Eines Tages sagte er zu ihm:
„Ich möchte, dass du einen kleinen Akt der Demut vollbringst… Trag diesen lächerlichen Federhut und erledige damit deine Besorgungen in ganz Rom.“
Der junge Mann war entsetzt. Was für ein Skandal! Wie peinlich! Aber er gehorchte, etwas beschämt, und ging auf die Straße.
Die Leute lachten, zeigten auf ihn – manche hielten ihn für verrückt. Als er zurückkam, sah ihn der Heilige an und sagte mit einem Lächeln: „Sehr gut. Heute hast du begonnen, dem Stolz zu sterben und zur Freiheit des Herzens zu auferstehen. Denn wer über sich selbst lachen kann, hat die Welt schon besiegt.“
Bemühe ich mich kontinuierlich, mich den anderen zu nähern?
Wie John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche, einmal sagte: „Meine Pfarrei ist die ganze Welt!“ Genauso sollte in jeder Gemeinschaft, in jeder Pfarrei oder an jedem Arbeitsplatz unsere apostolische Fürsorge nicht nur Katholiken gelten, sondern allen – Gläubigen oder Nichtgläubigen, denen, die wir vorschnell als „Fernstehende“ oder „Gleichgültige“ bezeichnen.
Wie Maria Magdalena, die Jünger von Emmaus, die Apostel oder sogar Paulus – nach der Begegnung mit dem Auferstandenen Christus sollen wir frei von aller Zukunftsangst leben. Von Furcht und Feigheit gegenüber ihren Feinden, besonders den jüdischen Autoritäten, wurden sie zu mutigen Verkündern der Frohen Botschaft, selbst unter Verfolgung und Lebensgefahr.
Zeigen wir, dass wir in diesen Ostertagen Momente besonderer Vertrautheit mit dem auferstandenen Christus erlebt haben, dass wir ihm unsere alten Ängste anvertraut haben, wie die Jünger von Emmaus, unsere Enttäuschungen – oder unsere Zweifel, wie Thomas.
Nur wer eine erneuerte Begegnung mit Christus hatte, kann die Frohe Botschaft bringen. Vor allem: Erzählen wir, teilen wir unsere kleinen oder großen Bekehrungen – wie wir es beim Examen der Vollkommenheit dürfen. Es ist dringend nötig, auch wenn es uns nicht immer so dringend erscheint. Die Nachrichten der letzten Monate, neue Formen der Gewalt, Konflikte in der Welt betreffen nicht nur die unmittelbaren Opfer, sondern verbreiten einen Schleier von Pessimismus und Hoffnungslosigkeit, der niemanden ganz unberührt lässt.
Möge unsere österliche Freude nicht künstlich sein, sondern Frucht einer echten Betrachtung des auferstandenen Christus.
In den Heiligsten Herzen von Jesus, Maria und Josef,
Luis CASASUS
Präsident












